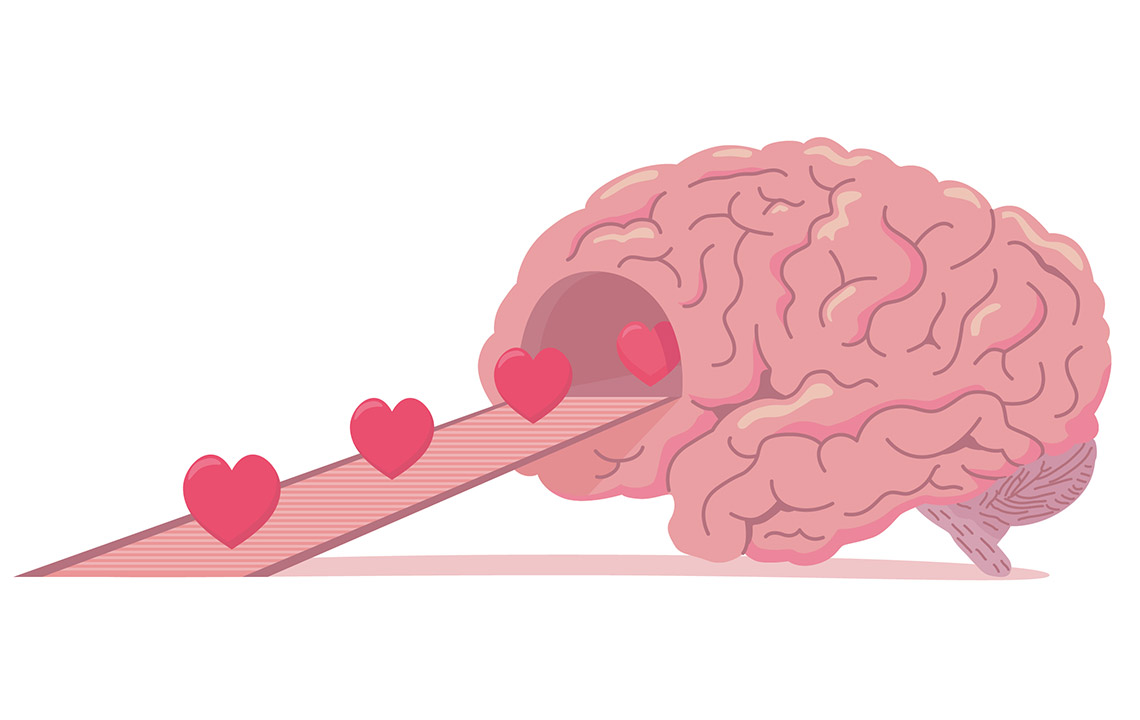Was geschieht in unserem Gehirn, wenn wir uns verlieben? Und wie unterscheidet sich die romantische Liebe in einer Beziehung von sexueller Lust, Mutterliebe oder Freunschaft? Diesen Fragen geht die Nerowissenschaftlerin Stephanie Cacioppo seit Jahren nach und überascht mit ihren Forschungsergebnissen.
Text: Norbert Classen
Wir alle kennen das Gefühl, verliebt zu sein – diesen Moment, in dem ein Blick alles verändert. Doch was genau geschieht bei einer romantischen Liebe in uns? Wie entsteht sie im Gehirn? Und was unterscheidet sie von anderen Formen menschlicher Nähe wie Freundschaft oder von sexueller Lust?
Für die Neurowissenschaftlerin Stephanie Cacioppo ist Liebe weit mehr als ein romantisches Ideal. „Liebe ist kein Gefühl – sie ist eine Motivation, ein Überlebensmechanismus“, sagt sie. „Sie ist die stärkste Kraft des menschlichen Gehirns. Ohne Liebe würden wir untergehen.“ Denn Liebe hilft uns, stabile Bindungen einzugehen, gemeinsam für unsere Nachkommen zu sorgen und soziale Isolation zu vermeiden – alles Faktoren, die unsere Gesundheit und unser Überleben als Individuen und als Art fördern. Cacioppo ist eine Pionierin auf dem jungen Forschungsfeld der sozialen Neurowissenschaften. Gemeinsam mit ihrem verstorbenen Ehemann John Cacioppo hat sie die Liebe in den neuronalen Schaltkreisen des Gehirns erforscht.
Was passiert im Gehirn, wenn wir lieben?
Lange galt Liebe als etwas, das sich wissenschaftlich kaum greifen lässt – zu subjektiv, zu emotional, zu kulturell aufgeladen. Doch moderne Bildgebungsverfahren wie die funktionelle Magnetresonanztomografie zeigen plastisch: Wenn wir verliebt sind, reagieren bestimmte Areale im Gehirn mit bemerkenswerter Präzision.
Aktiviert werden vor allem Netzwerke, die mit Motivation, Belohnung und Aufmerksamkeit in Verbindung stehen – insbesondere der Nucleus accumbens, ein zentraler Sammelort für Reize, die als lohnend oder bedeutungsvoll erlebt werden, sowie der ventrale tegmentale Bereich, eine Dopamin erzeugende Region im Mittelhirn. Gemeinsam bilden sie das sogenannte mesolimbische Belohnungssystem – das neuronale Fundament von Antrieb und Lust.
Das Gehirn registriert romantische Liebe also nicht wie ein klassisches Gefühl (etwa Wut oder Trauer), sondern als tiefen inneren Impuls – ähnlich wie Hunger oder Durst. Sie wird zu einem neurobiologischen „Wollen“: nicht etwas, das wir haben, sondern etwas, das uns antreibt. „Liebe motiviert uns, ein bestimmtes Ziel zu verfolgen – nämlich Nähe und Verbindung zu einer bestimmten Person“, erklärt Stephanie Cacioppo.
Eine Entdeckung der Cacioppos war besonders überraschend: Der Gyrus angularis, eine evolutionär vergleichsweise junge Region im Scheitellappen, leuchtet bei verliebten Menschen besonders stark auf. Dieses Areal gilt als eine Art integratives Zentrum des Gehirns: Es verknüpft Informationen aus verschiedenen Sinneskanälen – Sprache, Raumwahrnehmung, soziale Bedeutung – und bringt konkrete Eindrücke in einen größeren Zusammenhang. Besonders ausgeprägt ist dieser Bereich nur beim Menschen: Zwar kommt er auch bei anderen Primaten vor, doch erst im menschlichen Gehirn entfaltet er jene Komplexität, die symbolisches Denken, Empathie und Perspektivübernahme ermöglicht. Der Gyrus angularis scheint dafür verantwortlich zu sein, dass wir einer bestimmten Person ein tiefes emotionales Gewicht zuweisen. „Wenn wir jemanden lieben, wird diese Person zu einem Zentrum unserer inneren Landkarte“, erklärt Cacioppo. Er verbindet die konkrete Ebene mit der symbolischen – macht aus einer Berührung ein Versprechen und verleiht einem Blick tiefere Bedeutung.
Auch hormonell lässt sich Liebe klar vom bloßen Begehren unterscheiden. Während sexuelle Lust stark von Testosteron, Noradrenalin und kurzfristiger Belohnung geprägt ist, wirkt romantische Liebe eher langfristig: durch Oxytocin, Vasopressin, Serotonin. Diese Unterschiede lassen sich sogar von unseren Augen ablesen, wie Cacioppo in einer ihrer bekanntesten Studien gezeigt hat: Wer Liebe empfindet, blickt länger auf das Gesicht des Gegenübers, wer Lust empfindet, richtet den Blick auf den Körper.
Liebe ist nicht gleich Liebe
Liebe hat viele Gesichter – und sie alle zeigen sich auch im Gehirn. Denn romantische Liebe, sexuelle Lust, mütterliche Fürsorge oder platonische Freundschaft beruhen zwar auf verwandten biologischen Grundlagen, aktivieren aber unterschiedliche Netzwerke.
Romantische Liebe ist dabei das komplexeste Muster. Sie umfasst emotionale Nähe, sexuelles Begehren, langfristige Bindung und die Bereitschaft, in das Wohlergehen des anderen zu investieren. „Romantische Liebe ist wie ein neuronaler Fingerabdruck – einzigartig, aber messbar“, sagt Stephanie Cacioppo.
Sexuelle Lust aktiviert hingegen stärker den Hypothalamus (das Steuerzentrum für grundlegende körperliche Bedürfnisse), die Amygdala (das emotionale Alarmsystem des Gehirns) sowie hormonelle Systeme wie Testosteron und Noradrenalin. Sie ist impulsiver, unmittelbarer – ein biologischer Drang, der auch ohne emotionale Bindung bestehen kann. Freundschaft hingegen beruht eher auf Empathie, gegenseitigem Vertrauen und sozialer Synchronisation. Auch hier spielen Oxytocin und Dopamin eine Rolle, allerdings in einem anderen neurochemischen Gleichgewicht.
Am deutlichsten unterscheidet sich die sogenannte elterliche Liebe – insbesondere zwischen Mutter und Kind. Studien zeigen: Mütterliche Zuwendung aktiviert Regionen, die mit Fürsorge, Geduld und Schutzverhalten verbunden sind – etwa den präfrontalen Cortex, der für Planung, Impulskontrolle und Mitgefühl zuständig ist, aber auch Areale, die mit Belohnungserleben in Verbindung stehen. Diese Form der Liebe hat keine sexuelle Komponente, aber eine enorme Bindungskraft – hormonell getragen von Oxytocin und Prolaktin. (…) Mehr